Lybe Leser,
wo wart ihr letzte Woche? Ich will
jetzt keine konkreten Zahlen nennen, da diese bei Blogs wie diesem
ausnahmslos armselig ausfallen, aber bei der zweiten Ausgabe des
SPEKTAKEL
USA! haben so wenige geklickt, wie das letzte Mal so niedrig bei
der großen DC-Berichterstattung
im August. Erinnert ihr euch noch alle an diese magische Zeit?
Offensichtlich nicht bei der nachweisbaren Abwesenheit. Hat der
Filmfreund dieser Tage etwa die Schnauze voll vom guten alten
ehrlichen und verzweifelt abgeranzten Amerika, das sich in den
Facetten jener Zelluloidwerke zeigt? Dabei war dieser Tage doch die
dritte Debatte zur Präsidentschaftskatastrophe in Aussicht, also kann von
irrelevanter Berichterstattung eigentlich kaum die Rede sein –
what's going on?! Natürlich kann ich mir vorstellen, woran
sich die starken Gefälle in manchen Wochen erklären lassen, wenn
ich mir so die Statistiken und Suchbegriffe angucke, anhand derer
auch viele Italiener, Amerikaner, etc. zuschalten, während die
Deutschen vor allem nach den perversesten Begriffen schlechthin
suchen und hier mehr oder weniger fündig werden. „Devote
Haltung“, „Coming of Age Filme mit Jungs Masturbation“,
„Bruce Lee Todesfoto“ - das sind nur einige sexy Beispiele
an Google-Eingaben, welche hier die Klicks bringen und
verstärkt nahe legen, dass der Großteil der Leserschaft wegen der
schönen bunten Bilder, weniger wegen meiner inhaltlich
brisant-geilen Schreibkünste an Ort und Stelle aufläuft. Ich kann
es keinem verübeln, aber was soll ich aus diesem Feedback
herleiten? Und vor allem: Warum bin ich noch immer so furchtbar dumm,
kein Geld aus meinen Ressourcen zu schöpfen? Tja, da ich nicht rein
auf Porno umsteigen möchte und trotz meiner unverkennbaren Affäre
mit den USA nicht alles auf englisch niederschreiben will, wird die
Entscheidung schwierig, ob eine Neuerfindung stattfinden muss oder
mir schlicht egal sein kann, was ich dem Leser vorsetze. Ich denke,
eine gesunde Kombination aus beidem dürfte die Lösung bringen – auf den Punkt genau, damit sich auch niemand um
seine kostbare Zeit geprellt fühlen muss. Ich versuche mich mal ans Umstellen, in der Zwischenzeit könnt ihr ja in Martin
Hentschels neues Buch zur Eis-Am-Stiel-Reihe, „Zitroneneis, Sex
und Rock 'N Roll“, rein lesen, das vor kurzem auf Amazon
erschienen ist.
Kostet € 19,99, ist 382 Seiten dick
und bietet eine unvergleichlich umfassende Chronik zu jenen
deutsch-israelischen Produktionen, die von den Siebzigern an bis zu
den späten Neunzigern für frivolen Coming-Of-Age-Spaß mit
sexgeilen (vielleicht sogar masturbierenden) Jungs gesorgt hat.
Biografien, Interviews, Infos zu Trittbrettfahrern, zahlreiche
Behind-The-Scenes-Unglaublichkeiten und seltene Abbildungen
vervollständigen das Bild für jeden Fan, der die ganze nackte
Wahrheit auch vertragen kann. Wer im Jahre 2016 lebt, hat manchmal
eben keine andere Wahl.
Aber keine Sorge, manch Jahr wie z.B.
2001 war auch nicht gerade die Krönung der Leichtigkeit, so wie
einige Krisen aus jener Zeit bis heute noch nicht überwunden wurden.
Ganz recht, ich rede von Jon Favreaus erster Regiearbeit fürs Kino,
„Made“. Letzte Woche schon nach meiner Sichtung von
„Swingers“ befürchtete ich die Begegnung mit einem
weiteren kultverdächtig dialoggeladenen Ableger der
Scorsese/Tarantino-Tradition, der sich seinem Infantilismus nicht
ansatzweise so bewusst ist wie z.B. Eli Roths Kurzer „Restaurant
Dogs“ (1994) – und, wer hätte es geahnt, Favreau war wieder
mal ganz er selbst. Dabei mangelt es ihm gar nicht mal an Vorteilen,
so wie sich sein Narrativ - um zwei in den Mechanismen der Unterwelt
herumgereichten Boxern voller Geldsorgen - von der Hommage abgrenzt
und scheinbar weniger behauptet vom Lauf der Welt phibrosophiert,
stattdessen aber nun belanglos in der Faszination zum gefährlichen Gangster-Gestus
herumeiert. Buddy Vince Vaughn vermasselt ihm mit großer Fresse wie
gehabt oftmals die Tour, aus der Dynamik entwickelt sich für den
mitgehangenen wie mitgefangenen Zuschauer sodann die Art turbulente
Nacht, bei der so unbeholfen oft der harte Macker markiert wird, dass
der Film sich im Kern eben immer wieder von vorne aufdreht und daraus
schlussendlich einen moralischen Kodex unter wachsenden Kerlen zu
destillieren glaubt. Wenn man mit P. Diddy durch Clubs marschiert, mehrmals die
ganzen „Faggots“ von sich abgrenzt und untereinander wie
die gesamte Kundschaft einer Bostoner Bar kabbelt, ist's doch noch
etwas weit bis zum liebenswerten Charakterbezug, doch wenigstens
bleibt noch soviel Selbstreflexion, dass Vaughn als vermeintlicher Womanizer stets die Arschkarte zugereicht bekommt und sich allesamt letzten Endes auf das
Erziehen eines kleinen Mädchens konzentrieren – inklusive
drolligen Malkursen und Umarmungen. Seitdem ist Favreau auch mehr der
Kinderfreund unter seiner Generation an Kollegen geworden,
schließlich kann man von diesen mehr lernen, als von der hier
geballten Versager-Macho-Attitüde, die u.a. Famke Janssen als
zentrale Frau zur Stripperin und somit schlechten Mutter stilisiert. Ganz
schön kapital versumpft.
Erheblich aufregendere Minuten
verbringt man hingegen mit Shun'ya Itôs „Curse of the Dog God“
aka „Inugami
no tatari“ von 1977.
Die japanische Gruselgeschichte voll moralischer Bange ist vielfach
auf den Hund gekommen und allein deshalb schon sehenswert, bietet
aber auch kulturbedingt überschäumende Wellen der Gnadenlosigkeit,
sobald drei rücksichtslose Uran-Kapitalisten den kleinen Akita eines
noch kleineren Jungen überfahren und nacheinander vom titelgebenden
Fluch heimgesucht werden. Neben der Belagerung durch zig Schäferhunde
ist oftmals Seppuku angesagt, nachdem jeder spontan der
Unterlicht-Seuche verfällt, die mit ein bisschen Make-Up,
Schatten und Farbtemperatur filmtaugliche Krankhaftigkeiten
stilisieren kann, in jener „Exorzist“-geschwängerten Ära
der Besessenheit aber alsbald auch von ihren Herzdamen übernommen
wird, deren Opferbereitschaft sich zudem gerne von der
Dorfgemeinschaft betatschen lässt. Itô-san, Regisseur der
„Sasori“-Reihe, macht in der sozialen Gefangenschaft der Frau schließlich keinen Halt vor
exploitativen Eindrücken, holt Brüste raus und fährt maskierte Räudenbiker
zur Drangsalierung zwischen Fluss und Klippe auf, anhand dessen natürlich
bewusst wenig Ehre fürs männliche Geschlecht übrig bleibt.
Jenes hat
ja auch schon Natur, Religion und Hochzeitsriten beleidigt sowie Familienbanden getrennt, kriegt dafür explosive
Unfälle zu spüren, schlägt im Gegenzug aber mit abergläubischen
Racheaktionen zurück, die allerdings noch üblere Geister aus dem
Wind des Waldes heraufbeschwören. Die Effekte steigern sich Richtung
Finale sodann mit unglaublichen Eindrücken, fliegenden Hundeköpfen und
bisher verheimlichten Familienmitgliedern ins melodramatische
Schauerstück, bis das kleinste Mädel der Familie mit roter Robe
durch die Nacht springt, grell attackiert sowie mit übler Zunge
spricht, ehe der Antiheld ganz nach dem Formate Vater
Karras' die Schuld auf sich nimmt. Das Feuer unterm Arsch hört danach aber
gewiss nicht auf, weiß man ja schon aus „Jigoku“
- an dessen Tempo, Stilsicherheit und Zeremonien der Doppelmoral
erinnert der Film hier sowieso, obgleich der Faktor des Umgangs mit
der Atomkraft hier einen Zusatz kritischer Belehrung darstellt,
genauso einige Bremsschwellen im Spannungsbogen hinterlässt, wenn Itô-san manchmal
zu konventionell Schuld und Sühne abarbeitet. Doch wenn er mal
entschlossen im Blut herumstochert, ist der rote Geysir mit voller
mystischer Pumpkraft in die kalte Schnauze des Zynismus gerichtet.
Bleiben wir asiatisch, aber etwas
problematisch, um mal wieder bei Tsui Hark vorstellig zu werden,
dessen erste drei Teile der „Once Upon a Time in China“-Reihe
wirklich eine Probe der Ambivalenz darstellen, erst recht wie ihr
Regisseur politisch steht. Klar, man muss wirklich nicht alles am
Kino politisieren, aber in diesem Fall wird es schon trotz aller kultureller Schönheit nach wenigen Minuten unumgänglich.
Chinesische Filme, insbesondere solche Action-orientierten im historischen Rahmen, haben
irgendwie immer etwas Nationalistisches und Xenophobes an
sich, wenn dann auch noch von ikonischen Helden wie Ip-Man und Co.
die Rede ist – man braucht seine Fühler auch gar nicht mal so weit
ausstrecken, um jene Tendenzen bei Werken von Jackie Chan, Wang Yu
oder gar Bruce Lee festzustellen, wo vor allem Japaner dem zweiten Weltkrieg wegen allerorts zum Abschuss freigegeben werden. Dennoch sind die Plattitüden jener
Ideologien im ersten Teil der von Jet Li verkörperten
Wong-Fei-Hung-Abenteuer expliziter als der gewöhnliche Antagonismus zum Westen sowie eine gesteigerte Liga der Widersprüche, wenn
sich Harks Regie mit enorm visueller Aufregung dem
Zuschauer von außerhalb öffnet, in der Anwendung internationaler Techniken jedoch schamlose
Propaganda austeilt (immerhin um ein Vielfaches stimmiger und
beherzter als „Die letzte Schlacht am Tigerberg“). Plumpe Gwailo-Stereotypen, konstruierte Horror-Szenarien und gleichsam deftige Entmystifizierungen der pazifischen Nachbarn als Hort der Folter lassen
sich keineswegs einfacher entschuldigen, wenn man auch vom reellen
Rassismus und Kolonialismus der Besatzer weiß – so sehr
treibt Hark den Hass auf die Spitze, dass er die Melodramatik der
Heimatehre noch freiwillig dazu addiert und stets betonen lässt, wie
der Verlust der eigenen Sprache und Kultur schon von Vornherein bejammert, insofern auch bekämpft werden muss.
Die ideologische Schiene ist eben zu hardcore auf rechte Anbiederung und manipulatives Kalkül aus, geradezu kongruent energisch zum visuellen Ereignisreichtum aufwendigster Sorte - ein großzügiges Budget vonseiten Golden Harvests weiß sich zu nutzen. Jackie Cheung z.B. kehrt zwar mit dem perfekten Umgang der englischen
Sprache zurück, stottert seine Muttersprache aber nur schwer an der
cartoonhaften Trottelfigur vorbei, was Wong Fei Hung wenigstens noch als verbesserungsfähig toleriert und gegenüber absoluten Räuden verteidigt. Tante Yee (Rosamund Kwan)
wird das Leben ihrer Kamera sodann wichtiger im Angesicht eines
Großbrands als der traditionelle Fächer, der abgefackelt als Symbol
brachliegen muss, um Jet Lis Charakter auch endlich mal zu einem Ausbruch gesteigerter Wut zu verhelfen, obwohl sie eigentlich in ihn verschossen ist. Seine Darbietung ist leider größtenteils eher stoisch in der selbstverständlichen Weisheit denn wirklich dreidimensional definiert, lebt wie vieles am Film erst in der Akrobatik des
Lokalkolorits auf und hat daher narrativ enorme Schwierigkeiten, einen neben der beeindruckenden Kampffähigkeiten am Ball zu halten. Kurioserweise scheint er zur zweiten Hälfte
hin sowieso mehr nur im Geiste anwesend zu sein, sobald Verräter unter den
Weißen und Kollaborateure aus einheimischen Schutzgelderpressern eine
Massenverschleppung von Frauen zur Zwangsarbeit nach Amerika
konzipieren, vorher schon die vermeintlich gefährliche Bevölkerung
dezimieren und dabei noch von einem scheinbar unzerstörbaren Kung-Fu-Meister
angeleitet werden. Irgendwie gerät der Film eben so episch bei all diesen Strängen, dass er zeitweise seinen roten Pfaden verliert, verwirrt um die nationale Identität
wettert, dann aber wieder einen gütigen Priester von außerhalb
präsentiert, mit westlichen Klamotten kokettiert und schließlich in
seinen besten Szenen noch als aufreizendes Wirework-Showcase
herausstechen kann. Davon mal ab ist das Titelthema ein regelrechtes Ohrwürmchen im Chorus unentschlossener Signale.
Wie wankelmütig sich Hark auch
wandeln kann, beweist der Nachfolger, in dem Wong Fei Hung
ausgerechnet die Weißen, nun Kollegen seiner medizinischen
Ambitionen, vor den rechtsextremistischen Anschlägen der
„Weißer-Lotus“-Sekte beschützt. Wie aufrichtig Hark diese
Gegenthese nun meinte (wirklich echt lässt sich keine Begegnung mit Vertretern von außerhalb empfinden) oder das unvermeidliche Arrangement mit
kulturellen Einflüssen anhand einer Serienstruktur motivieren
wollte, sei mal dahingestellt – auf jeden Fall erlaubt es einen,
unbelasteter an eine stringendere Geschichte heranzutreten, in der
sich Tante Yees Liebe zu Wong
Fei Hung mit festen Schritten weiterentwickelt und konzentrierte
Szenarien der Belagerung einen sympathischen Beschützer aller aus eben diesem
Herren machen. Für Hark bietet sich zudem manch Projektionsfläche
für morbide Eindrücke, die am frühesten Anfang seiner Karriere
noch omnipräsent waren, hier Häute abziehen, in der
Rücksichtslosigkeit der Sekte Kinder durch die Helden umbringen
lassen oder auch mal Hunde zu Menschenfutter verarbeiten. Donnie Yen
ist als verräterischer Kommandant ebenso vor Ort, bedingt dann auch
Angriffsflächen für luftige Kampfsequenzen, die höchstens noch von
sporadischen Honk-Momenten übertroffen werden („Ihr seid alles Flaschen!“). Nichtsdestotrotz
bleibt der Eindruck, dass Teil Eins trotz aller Hässlichkeit nicht
ganz so blass war wie sein Nachfolger, zumindest wilder auf Eigensinn
pochte als dieser Kompromiss einer Annäherung durch
Akupunktur und Kampfgeist. Der dritte Teil hingegen begibt sich von
den Feindbildern und nationalen Empfindungen her wieder mehr ins
Territorium des Erstlings, beschränkt sich dabei aber hauptsächlich
auf interne Intrigen und Kampfschulenrivalitäten, weniger auf Generalisierungen ganzer Kontinente anhand plumper
Propagandaphrasen.
Wesentliche Variationen von Altbekanntem bleiben
aber ebenso aus – Tante Yee und Wong Fei Hung reden zwar inzwischen
schon von Heirat, bleiben im Endeffekt aber immer kurz davor; ihre
Kamera nimmt sie noch immer enorm wichtig, inzwischen wird das Medium Film
aber auch gerne zur Verewigung der Kampfkünste und stichfester
Beweise genutzt, damit Hark nicht ganz der Hypokrisie beschuldigt
werden kann. Tolle Löwentänze lassen sich neben all dem noch als
Highlights der gewohnten Schauwerte feststellen, doch bei einem Film, der wie alle Teile an
die zwei Stunden Laufzeit innehat, verlaufen sich die Zwischenräume
dazu immer wieder in konventionelle Bahnen, die den gesamten Streifen
letztlich als Lückenfüller erscheinen lassen. Zwar ein solider
Lückenfüller, aber keiner, nachdem man noch mehr von Wong Fei Hung
sehen zu müssen glaubt - zwei weitere Filme und einige Trittbrettfahrer sollten dennoch folgen. Kurios ist die Reihe an sich allerdings
durchaus und bestimmt nicht ohne einige Höchstwerte des Charmes umgesetzt, auch wenn sie mir hauptsächlich eine stärkere kritische
Distanz zu Tsui Hark beigebracht hat. Niemand bleibt unschuldig in
dieser Welt, aber so ein wechselhafter Bezug zum Werk eines
Regisseurs ist nicht die schlechteste Sache. Mehr über die Gründe
für solch ein Hin und Her bei gerade diesem Mann lese ich
wahrscheinlich demnächst eh im von Esther Yau herausgegebenen
Sammelband analytischer Essays zur Hongkonger New Wave nach - „At
Full Speed“, so der Titel. Was ich der Vorschau da an lesenswertem
Potenzial entnahm, würde ich Euch da draußen ebenso gerne ans Herz legen.
Danach versuchte ich mich jedenfalls
wieder ein Stück weit mit Guy Maddin zu versöhnen, dessen „My
Winnipeg“ sich vom stilistischen Ansatz her dermaßen schnell
totreiten ließ, dass die inhaltliche Ebene, so sehr ich mich auch
für diese interessieren wollte, geradezu ersoffen war im Arsenal
verquaster Sperrigkeiten und narrativer Abzweigungen. Immerhin kamen
dann auch Pferdeköpfe vor, die aus dem ganzen gefrorenen Fluss
herausragten - in jedem Übermaß lässt sich eben doch noch was finden, was bei einem hängen bleibt. Mit ähnlichen Problemen hat sodann auch
„The Saddest Music in the World“ zu hadern, die geradliniger
auf den melancholischen Irrwitz Winnipegs zusteuert, mitunter aber
weiterhin an der Hektik ihres Autoren scheitert. Maddin wechselt die
Formate wie ein waschechter Oliver Stone, will sich aber in einer
Variation des Screwballs à la Old Hollywood
wiederfinden, der er ein wildes Schnittgewitter aus statischen und
entfesselten Kamerabewegungen aneignen möchte, beinahe gleichsam
überladen auf der Audioebene mitgestaltet, während die optischen
Filter schlicht keine Ruhe finden. Diese grundlegende Dissonanz des
Äußeren zum Inneren ist auf die Dauer natürlich anstrengend, bis
dahin kommt aber durchaus so manch genialer Witz aus der Mischung des Naiven mit dem Profanen heraus, wie absurd
die Ära der großen Depression in einen Wettbewerb um das traurigste
Lied der Welt verwandelt wird, zu dem sich alle Nationen des Globus
am Gipfel des schlichten Leidens, Winnipeg, antreffen.
Im
charakterlichen Ensemble sind die vergänglichen Beziehungskreise
zwischen Chester Kent (Mark McKinney), seinem Vater Fyodor (David
Fox), Bruder Roderick (Ross McMillan) sowie den Frauen derer aller
Leben, Lady Helen Port-Huntley (Isabella Rossellini) und Narcissa
(Maria de Medeiros), ohnehin tolle Spannungspunkte für den Flirt mit
der Tristesse und der Verklärung wahnsinniger Einsamkeit bis hin zur Musicalnummer der Todessehnsucht mit einer ordentlichen Portion Pazzaz - gerade
mal etwas über dem Status einer Karikatur hinaus und doch so gepeinigt vom
Schmerz des Planeten, dass dem Kurzweil ständig zugespielt wird und
gleichsam keine Zeit zum Atmen bleibt. Manchmal eine echt tolle Sache
und innerhalb der großen Kulissen mit Stock-Footage-Vermengungsflair
als Bündel an hysterisch schönen Einfällen aus dem Stand heraus ein Knallbonbon, teilweise
aber auch bis zur Redundanz hektisch überdreht bzw. am Zuschauer
vorbei inszeniert. Was hätte Maddin denn zu verlieren, wenn er sich
ein bisschen mehr Erdung und Sinnlichkeit erlaubt, um sein surreales
Großwerk greifbarer, gar pointiert durchscheinen zu lassen, als dass er
es immer wieder in der Überhöhung des Überhöhten zu verschleiern
versucht? An jenem Rätsel verfremdeter Schönheiten wird der
Widerspruch von Showfaktor und Misere vielleicht gänzlich
vervollständigt, kann und soll sodann ja nicht weniger als
delirierend-frustrierend wirken. Auf jeden Fall eine gute Erinnerung daran, dass
der Winter kommt und sicherlich keinerlei Übel der Welt verstecken können
wird.
Zurück zu Jet Li und dem Jahr 2001,
schließlich verschlägt es den guten Mann zu mehreren Welten, da
James Wongs „The One“ zur Jagd durchs Multiversum ansetzt.
Als Superverbrecher Yulaw entledigt er sich dabei Stück für Stück
seiner parallelen Pendants, um die durch alle alternativen Fassungen
seiner selbst aufgeteilten Kräfte in sich zu vereinen. Er ist quasi
der Kurgan, wenn dieser jedes Mal sich selbst enthaupten würde –
übrigens auch eine tolle Gelegenheit für Li, sich in dutzende dumme
Posen einzuleben und generell engagierter als ein Wong Fei Hung
aufzuspielen. Gejagt wird er dabei von seinen ehemaligen Kollegen des
MBI (Multiverse Bureau of Investigation), Roedecker (Delroy
Lindo) und Funsch (Jason Statham mit bereits schütterem Haupthaar),
die Yulaw davor aufhalten wollen, auch seine letzte Gegenvariante zu
vernichten, da dies ungeahnte Folgen für die Galaxis bedeuten
könnte. Doch wie das High-Concept so will, entkommt er und
bedrängt nun den ausgerechnet enorm gesetzestreuen Polizisten Gabe
Yu Law im Los Angeles unserer Erde, welcher außerdem ebenso
unglaublich starke Kräfte besitzt, sich aber keinen Reim darauf
machen kann. Die actionreiche Konfrontation der Beiden ist
unausweichlich, für eine Spielfilmdauer von unter 90 Minuten recht
optimal ausgefüllt und voller Missverständnisse, bei denen die
Polizeikollegen und Freundin T.K. (Carla Gugino) erst recht nicht
wissen, wie ihnen da zumute sein soll. Solch einer Prämisse nicht
total unterhaltungsorientiert zu begegnen, wäre James Wong
jedenfalls nimmer eingefallen, weshalb man sich mit der Transparenz
des Ganzen recht schnell verstehen kann, nicht unbedingt anfreunden
muss. Sein Film ist zudem recht jugendlich getrimmt, stets auf
Schauwerte zusteuernd sowie die inzwischen typischsten
Nu-Metal-Anlaufstellen auf dem Soundtrack vertretend,
was ihn zum Relikt seiner Zeit, aber auch ein gutes Stück unbedarft
macht. Einige Merkmale sind rückblickend dennoch leicht
bemerkenswert, wenn man sie Witte-mäßig aufbauscht: In jedem
Universum, ob es nun von Al Gore oder George W. Bush als Präsidenten
der USA geführt wird, setzt Wongs Perspektive zur Etablierung stets
auf die jeweiligen Gefängnisse an, in denen Fernseher mit den
jeweiligen Staatsoberhäuptern laufen. Das Problem der Mass
Incarceration, das sich hier schon prophetisch abzeichnet, ist
inzwischen ein hitziges Wahlkampfthema angekommen, hier zudem von
einer durchgängigen Gewalt gegen Autoritäten unterstrichen, bei
denen der Status der Uniform in Fakern wie Yulaw ohnehin
ambivalent aufgefasst werden kann.
Was für ein düsteres
Gesellschaftsbild, das hier jeweils zugrunde liegt, selbst im
comichaften Ausbau des suburbanen Normalolebens nie vollständig
aufgehoben wird. „The One“ mag in dem Gefühlsarrangement
zwar auch nur ein Produkt seiner zeitgeistlichen Symptome sein,
Ästhetik und Milieu irgendwo zufällig zwischen Rodney King und
„Matrix“ gefunden haben, aber es wirkt jedenfalls nicht
vollkommen abwegig, dass der PG-13-Film von der FSK weiterhin erst ab
18 freigegeben ist – die damalige Begründung stützte sich
angeblich auf das Echo zu den Amokläufen in Erfurt und Columbine,
irgendwie verliert der Film diese Bezüge auch dann nicht, wenn die
Versionen Jet Lis - ob gut oder böse stets obercool - hier manch
physikalischen Wahnwitz abziehen. Multischläge im Speedrausch,
Supersprünge, mit Leichtigkeit metallbiegende Tritte oder auch das
Zerquetschen des Gegners mit zwei Motorrädern in den Händen – bei
der Bandbreite an Manövern dürfte Terence Hills „Supercop“
bestimmt ebenso der letzte seiner Art im Multiversum sein. Gleichsam
schnippisch arbeitet sich der Film durch sein
Sci-Fi-Action-Prozedere, wie es ein ähnlich konstillierter
„Demolition
Man“ noch satirisch gefüttert hätte, hier stattdessen mit
einer Naivität funktioniert, die in ihrem Jungskino auch soweit ist,
keine Aufmerksamkeit auf Gabe Yu Laws asiatische Herkunft lenken zu
müssen oder gar Rassismus zu thematisieren, da die multikulturelle
Kollegenschaft sowie Freundin T.K. wie selbstverständlich eher vom
gegenwärtigen Fall der Identitätskanonade eingenommen werden.
Vielleicht spielt der Film doch in einem vorteilhafteren
Paralleluniversum zu unserem eigenen, höchstwahrscheinlich Kino
genannt. Okay, ich spare mir jetzt noch weiteren schnulzigen Pathos
zum Medium, schließlich muss man nicht mehr als nötig aus einem
eskapistischen Reißer wie diesem rausholen. Aber man darf schon
zugeben, dass die Actionszenen - vor allem im Duell Li gegen Li - in
ihrer eleganten Klarheit weiterhin frisch mitziehen lassen, das
Narrativ voller Klischees und Grellheiten ohne jeden prätentiösen
Ernst launig zur Tat schreitet, allerdings auch den Spagat zwischen
Unschuld und reeller Zwiespälte repräsentiert, wie er ab 2001 immer
präsenter, gar aufgehoben wurde. Oder könnte man sich nach z.B.
„The Dark Knight“ noch einen solchen Film wie „The
One“ vorstellen? Gut, beide besitzen eine hohe Anzahl an Hunden
(siehe „Der
Hund im Film“, Achtung Eigenwerbung).
Apropos, wie unmöglich wäre
inzwischen eine Verfilmung wie jene von Kenneth Branagh zu „Mary
Shelley's Frankenstein“? Im Zuge von „Bram Stoker's
Dracula“ produzierte Francis Ford Coppolas American Zoetrope
auch diese Adaption als eine Operette für die Leinwand, bei der von
Vorlagentreue nur oberflächlich die Rede sein kann, während im
Innern pausenlos das Herz der um Aufregung bemühten Neunziger pocht.
Branagh erlaubt sich vielleicht weniger expressionistische
Spielereien und Effekte als Kollege Francis Ford, doch die Unmengen
an Zoom und Bang, die in seiner Interpretation
vorherrschen, definieren Horror auf eine Art, wie er seitdem nimmer
mehr so romantisiert und brutalisiert zugleich auf den Mainstream
losgelassen wurde. Nun sollte man nicht soweit gehen, das Ganze in
„Meat Loaf's Frankenstein“ umzubenennen, schließlich ist
das Monster (Robert De Niro) zwischen allen Ambitionen des selbst
inmitten der Cholera flamboyant besessenen Viktor Frankenstein
(Branagh selbst, dauernd mit nacktem Oberkörper unterwegs) für ein
relativ zärtliches Portrait des vom Halbgott verstoßenen
Menschenwesen gut, das vielleicht einen bedachteren Film erfordert
hätte. Der Brite Branagh agiert in seiner Führung allerdings so
amerikanisch, dass er sich nicht schneller an die Kreation des
Unmenschen machen könnte, obgleich die Rahmenbedingungen entschieden
vom Gros an Adaptionen abweichen, vermeintlich introspektiv bei der
Kindheit Frankensteins ansetzen, seine erste Begegnung mit
Adoptivschwester/zukünftige Ehefrau Elizabeth (Helena Bonham Carter)
sowie den Tod der Mutter knapp 20 Jahre später aufzeichnen, an deren
Grab er schon explizit proklamiert, dass er nach einem Ende des Todes
suchen wird. Solche plakativen Kernsätze wie später auch „I
will have my revenge, Frankenstein!“ ergänzen sich mit Szenen,
in denen er anhand einer einzelnen blitzenden Wolke (witziger Effekt,
ne) seinen Bezug zur Elektrizität herstellt, während sich die
Kamera schon schwindelig dreht, um die Fassung der Charaktere darin
zu begreifen. Das hört auch dann nicht auf, wenn der gute Viktor aus
der Schweiz zum Studium nach Ingolstadt zieht und dort solange von
den Professoren zum Thema Leben und Tod ignoriert wird, dass er sich
an den leicht abtrünnigen Dr. Waldeman (ein unerkennbarer John
Cleese) hängt und dessen Experimente mit dem Nachleben zu beerben
gedenkt.
Doch hätte er mal auf die Vorzeichen des Films gehört, die
eine elektrisch wiederbelebte Affenklaue zum Knochenbrecher machen
und eine gleichsam reanimierte Kröte mit Glas-sprengenden Kicks
ausstatten, dass man schon die Ninja Turtles erwartet. Das
audiovisuelle Konzept platzt ohnehin fast aus allen Nähten, so
kinetisch und detailreich Branagh die Gotik als Abenteuer streift,
Blut sowie Fruchtwasser spritzen lässt und Patrick Doyles Musik
einen rührseligen Bombast in Richtung altdeutscher Dramatik à la
Wagner thematisiert; in all dem Trubel aber fast schon vergisst,
welch philosophische Kernspaltung in Shelleys Stoff gebettet ist.
Wenn er selbst als Schauspieler involviert ist, versucht er dieser
zwar in ausgewählten Szenen mit theatralischer Routine
entgegenzukommen, doch die Motivation zu Manie und späteren
moralischen Zwiespälten kann sich schon vom gehetzten Drehbuch
nimmer glaubwürdig gewichten, höchstens nach CliffsNotes-Manier
kohärent/spontan zusammenfassen, was ihn zum Zerstückeln von
Gliedmaßen gebracht hat und vor allem mit was für einer
unerklärlichen Apparatur er die Wiederbelebung ausführt. Zwischen
den Zeilen ist insofern nicht viel zu holen, packend kommt das
trotzdem halbwegs auf den Punkt, dass da ein Halbgott dem Tod trotzen
will, dem profunden Grauen seines Handelns aber erst in dessen allzu
menschliches Gesicht blicken muss, um seiner Verantwortung dafür aus
dem Weg gehen zu wollen, nachdem er sich allen anderen verschlossen
hatte. So hilflos der Mensch eben in die Welt geboren wird, ist auch
das Monster nun verloren zwischen Leben und Tod, seinem Aussehen nach
von allen verjagt und zwischen den Leichenbergen der Cholera
versteckt, ohne Sprache, nur mit „The One“-artigen Kräften
binnen der Verwahrlosung ausgestattet, wie Branagh das frühe 19.
Jahrhundert eben auch in der extremsten Kluft zwischen Arm und Reich
stilisiert, Frankenstein selbst quasi zum Bösewicht/Feigling der
Vernachlässigung formt. Später wird sein Monster ihm auch klar
machen, wie sehr es zwischen unbändigem Zorn und unendlicher Liebe
pendelt, vom Vater eine Weisung braucht, ihn für seine
Existenz hasst und doch ergeben um ihn trauern wird.
Das Monster als
empathisch-humaner Kern, abgekoppelt vom künstlichen Nabel eines
Göttergleichnis, funktioniert eben auch, weil es als einer der
wenigen Faktoren des Films langsam ist, Zeit zum Wachstum
erhält, sich von Grund auf gut für eine armselige Familie im Wald
einsetzt, die Belohnung einer kleinen Rose im Ärmel pflegt und dann doch von deren Reaktion auf seine Erscheinung
enttäuscht wird. Klar kann man da amerikanisiert heraus lesen:
„Anders sein tut weh.“, doch das Verständnis für den
Außenseiter - auch anhand eines blinden Mannes, der sein Mitleid in
der Abtastung des Gesichts ausspricht - kauft man noch am Ehesten ab,
ehe Elizabeth ihrer Sehnsucht für Viktor nach zur Hochzeit bewegen
will (klingt nach „Immensee“,
ebenso voll mit Tänzen, Erinnerungen und rahmenbildenden Flashbacks
im Schnee) und ansonsten nicht damit leben könnte, was er vor ihr
verheimlicht. Die anschließende Hochzeitsnacht inklusive Coitus interruptus
ist durchaus wieder Meat-Loaf-verdächtig auf den Spuren anderer
Romanverfilmungen nach Movie-of-the-Week-Prinzip unterwegs,
demnach der kitschige Kontrast zu Begegnungen im Eis, die
Frankenstein mit seinem verlorenen und wütenden Monster eingeht, um
weitere Todesfälle (nach Viktors kleinem Bruder und einer
Bediensteten) im Nachspiel seiner Verantwortung zu vermeiden. Wie in
Coppolas Dracularama ergibt sich eine Dreiecksbeziehung zwischen
Mann, Frau und Monster, was die Angelegenheit für Frankenstein
selbst noch mal pointierter ins Herz schneiden lässt, aber eben
wieder auch auf Branaghs operettenhafte Attitüde zurückweist -
allein diese riesige Treppe und manch ausgeschrieenes „No!“
inklusive Kamerafahrt in die Lüfte. Die Vermengung dieses brachial
zelebrierten Körpers mit der durchaus präsenten Gehirnmasse an
existenziellen Dilemmata scheint nicht durchweg reißfest,
enthusiastisch und doch verhalten, manchmal sogar passiv am Dasein seiner
Kreaturen interessiert. Es mangelt an Intimität, doch genau die
sticht im Kanon des Expressiven am Gelungensten heraus, bis die
Schlussminuten beides konträr wie stimmig als Klimax
leidenschaftlicher Gewalten vereinen. Ganz nach Art des Monsters:
Durchaus optimierbar, als Imperfektion dennoch sehenswert.


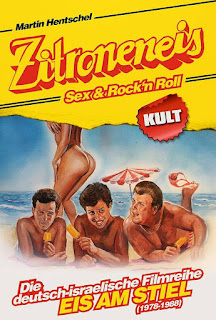





























Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen