IM SPINNWEBHAUS - Ab und an
erfreut es, einem Film begegnen zu dürfen, der sein stilistisches
Anliegen nicht als Zwang versteht, sondern anhand jener Grundlage
auch Elemente einfließen lassen darf, die normalerweise der
Subtilität halber eliminiert werden müssten, sei es verdeutlichende
Symbolik, Musik oder dramaturgische Kernsätze auf dem Pfad zur
manifestierenden Fantastik. Im Fall von Mara Eibl-Eibesfeldts
Debütspielfilm macht das ohnehin nochmal Sinn, wenn die kindliche
Perspektive eine verstärkte Rolle dort spielt, wo diese in ihrer
Selbstversorgung allein gelassen wird, nachdem die Mutter (Sylvie
Testud) für einen Kampf gegen Dämonen im sogenannten Sonnenthal das
Feld geräumt hat. Jene Ansage besitzt zweifellos befremdlichen
Anklang, schließlich ist das Narrativ in einer zeitgenössischen
Provinzstruktur verinnerlicht, gewissermaßen aber auch zeitlos in
seinem Prozedere kreiselnd, so wie das Schwarz-Weiß der Kamera
(Jürgen Jürges) Kontraste verstärkt und geradezu in einer
Zwischenwelt des Verlorenen lagert. Der gotische Reiz dieser
Rahmengestaltung fließt folglich auch in die Wahrnehmung der
Protagonisten ein, deren Häuslichkeiten ohne Aufsicht Erwachsener zu
einem Keimherd sondergleichen verkümmert, Massen an Spinnweben
herbei fördert, im Mangel an Einkommen auch Energieressourcen
abstellt, bis sich das Trio an Kids in ihrer selbst zusammengebauten
Höhle verkriecht.
Die Höhle, jenes Fort aus Stühlen,
Decken und liebgewonnenen Kleinigkeiten ist durchaus eine kindliche
Kunst, die jeder irgendwann mal mitgemacht hat, als sei es ein
Urinstinkt aus vergangenen Jahrtausenden der Evolution - zurück in
die Geborgenheit kleinster Zellen, in jenem Kontext aber auch zum
Zusammenhalt unter den Umständen ungewisser Einsamkeit. Bis dahin
verfestigt sich der Film aber auch nicht zur gnadenlosen Dramatik, im
Gegenteil. Der älteste von dreien, Jonas (Ben Litwinschuh),
übernimmt so gut er kann den Haushalt und mogelt sich durch die Welt
nachfragender Erwachsener, während er seinen Geschwistern Wahrheit
und Pflicht zugleich auf den Alltag zu schreiben fähig ist - bis zu
einem gewissen Punkt, versteht sich. Seine vorgezogene Reife ist eben
nur eine erforderte Maßnahme, deren Qualifikation soweit reicht, wie
ihn die flapsigen Sprüche seines Bruders Nick (Lutz Simon Eilert)
und die drollige Ziellosigkeit der vierjährigen Schwester Mielchen
(Helena Pieske) nicht vorzeitig aus der Fassung bringen, wohlgemerkt
der Organisation mit Schule, Kindergarten, Ernährung und Co. wegen
auch zu Tabletten treiben. Der erforderte Hang zur Kompetenz und
Autorität liegt eben auch im Zwiespalt mit dem Kindsein, was eine
tief schürfende Verletzlichkeit offenbart und genauso von der
Inszenierung empathisiert wird, ohne von den kleinen Darstellern
forcierte Emotionen und Phrasen zu verlangen, so wie jene
Ausnahmesituation am inneren Kostüm der Unschuld anschlägt.
Die Schuld wird aber auch nicht auf die
Mutter abgeladen, so wie ihre Psyche am selben Subjekt Liebe und
Schrecken gleichzeitig vorherrschen lässt (zeigt sich auch im
Verhältnis zum Vater, dem sich die Kinder ebenso nur ambivalent
öffnen können), vielleicht schon von Vornherein im Stil so
definiert, in zerrütteten Familienverhältnissen binnen trister
Provinzialität womöglich aber noch befeuert wird, so finster die
Nacht voller Bäume und verfolgender Lichter auf die Seele drückt.
Dies setzt sich auch bei Jonas fort, der auf seinem von „Nobody
knows“ (ferner auch „Fast Food Family“) inspirierten
Weg hilfloser Verantwortung noch der urigen Gestalt Felix (Ludwig
Trepte) begegnet, einem rätselhaften Goth voll diebischer Impulse,
welcher einem magischen Wesen ähnlich Wünsche erfüllt, zusammen
bei nächtlichen Einbrüchen ins Lager des örtlichen Supermarkts
aushilft und doch nie von einer absoluten Sicherheit zeugt, so wie er
einen Fluch an Jonas' Situation zu erkennen vermag. Die Omen häufen
sich sodann im Strudel der Verwahrlosung und Armut, aus dem man nicht
ausbrechen kann, so wie die Regeln der Mutter dafür Sorge tragen
sollen, dass man sie ihrer Verfassung wegen nicht von ihren Kindern
trennt, was natürlich auch eine ungesunde Abhängigkeit erschafft,
wenn Jonas und seine Geschwister das Vertrauen in einer Lücke
aufrechterhalten müssen, welche allesamt in ein Vakuum einbrechen
lässt.
Die Liebe im Umgang miteinander scheint
aber stets ungebrochen, so wie die Kinder eben auch keinen Zynismus
absondern, sei es nun durch Mierchens Versuche des „Piep piep
piep, wir haben uns alle lieb“ beim mickrigen Abendessen oder
in Nicks Aufmüpfigkeit der Empathie zur Schwester wegen, um ihren
Geburtstag in jenem Loch von Zuhause noch gebührend feiern zu
dürfen. Sich an den Kleinigkeiten festhalten zu müssen, auch die
Verzweiflung aller spüren zu können, in der Jonas seiner Rolle
wegen auch fast zur Kapitulation getrieben wird, macht eben das
tragische Herzstück dieses Films aus, der aus der Sorge heraus
sodann auch in die entlegensten Winkel schauen kann, um die Hoffnung
am Raben und am Friedhof vorbei ersehnen zu können, so vergänglich
er auch die Behütung der Erwachsenen zeichnet, wie hilflos diese
durch Jonas der Intervention verwiesen wird, wenn die Extreme seines
Daseins mehr als nur eventuell die Trennung von seiner Familie
bedeuten würde, auch wenn sie bereits das Existenzminimum erreicht
haben - zumindest zusammen in verschworener Schweigepflicht.
Erstaunlich ist, dass jene Ballung der Zwänge dann eben doch noch
eine Fülle an Perspektiven aufbietet, visuell dynamisch bleibt und
auch manch musikalische Dramatisierung glaubwürdig anbandelt, so
natürlich das Ensemble diese und sich selbst mitnimmt, wie sich
zudem allgemein das Unglaubliche mit wahrhaftiger Selbstzerstörung
ergänzt.
Letzteres ist eben ohnehin selten
nüchtern zu begreifen, so profund der Sachverhalt schon emotional
gesehen ankommt. Nicht, dass die Form hier zur Sentimentalität
greifen müsste, doch die Nähe menschlicher Erfahrung traut sich
hier einfach auch, in die finstere Verzerrung des Irrationalen zu steigen, diese im Selbstverständnis aufgehen zu lassen, zärtlich
und furchterregend zu gestalten, während die realen Konsequenzen
stets geerdet bleiben, vonseiten der Kindlichkeit eh nur bedingt
beeinflusst werden können, aber Verständnis erhalten und ihre
Ängste daher genauso irrational in naiven Gesten verbrennen.
Gleichsam schickt sich auch der unberechenbare Faktor Felix an, das
gegebene Chaos einer disfunktionalen Familie aus eigener Erfahrung
nachvollziehen sowie umsetzen zu können, worauf die vorzeitige
Wiederherstellung einer gewissen Norm gleichsam keine Spuren
vorheriger Desolation zu verwischen imstande sein dürfte (siehe auch
die einigermaßen geistig verwandte Netflix-Serie „Stranger
Things“). Mit moralischen Eindeutigkeiten hält sich diese Mär
dann schlussendlich auch zurück, zumindest ist fürs Erste eine
Sicherheit gegeben, die gleichsam temporär das Kindsein
rekonstruiert, aber nicht aus jenen Kontrasten des Schwarz-Weiß
entlässt - man wird ja auch nicht jünger. Dass solch bittersüße
Wahrhaftigkeiten im Sinne eines Films so oder so nicht ohne
Konstruktion auskommen, wird durch dieses Beispiel gewiss nicht
aufgelöst, in Sachen kraftvoller Vermittlung macht jene aufmerksame
Studie des inneren wie äußeren Zerfalls aber keine halben Sachen,
um das Kind als wachsenden Menschen wahrzunehmen, der mit den
Erwachsenen ebenbürtig zwischen den Fronten von Realität, Idealen
und Ängsten zu bestehen versucht.
(Anmerkung: Die online erhältlichen Abzüge der Filmposter sind auflösungstechnisch der letzte Scheiß, daher der Screenshot)
48 STUNDEN BIS ACAPULCO - Zurück
auf Anfang, Blick frei für Klaus Lemkes Langfilmdebüt, welches als
Reflexion zum Genrekino zeitgenössischer Natur scheinbar wenig mit
dem Oberhausener Manifest gemein haben wollte. Von einem Beispiel
dessen, was bei jenem Regisseur später zum eigenwilligen Format
avancierte, könnte man dennoch nicht zu 100 Prozent reden, so
verhältnismäßig kontrolliert (zudem von Max Zihlmann geschrieben)
auf den Spuren von Goddard, Eskapismus, Noir und Zeitgeist-Chic
gegangen wird, um das Abenteuer in der Desillusionierung zu finden.
Lemke selbst schien jene Erfahrung im Sinne seines Bezugs zum Kino
innerhalb dieses Films sowie dem Nachfolger „Negresco**** - Eine
tödliche Affäre“ gemacht zu haben, weshalb die Jahre darauf
mehr wahre Typen in seinem Werk Platz nahmen. Der Ansporn zur
Verwirklichung dessen markiert hier jedoch schon sein Revier, so wie
aus den Topoi ein geiles Ideal gebildet und gebrochen wird. Die
Ballung an Stilmitteln weist liebevoll und schnurstracks auf das hin,
was dem jungen Menschen von der Leinwand aus als Sehnsucht anschlägt,
mitunter auch verkauft wird, über die Kolportage hinaus aber die
Freiheit verspricht, wie man sie sich offenbar am ehesten verdienen
kann: Mit Macht, Kühnheit und Coolness hinaus aus dem Mief der
Gewohnheit. Lemke versteht allerdings schon in hiesigen Gefilden
solche Werte zu projizieren, wenn sich Roland Kovacs Musik wie ein
Italo-Western über München legt, die tollen Schlitten auf ihre
Designer-Villen steuern, deren Fahrer der Party bewusst fremd
bleiben; Sex, Frühstück und Swimming-Pool im wahrscheinlich ebenso
gepachteten Sommer dulden. Der messerscharfe Schnitt und die
ebenbürtige Kameraführung (u.a. Niklaus Schilling) zwischen
losgelöstem Trieb und schleichendem Raubtier suggerieren dabei ohne
Beihilfe dramaturgischer Behauptung den Meister, Chers „Sunny“
liefert dazu die passenden Akkorde.
Gruner (Alexander Kerst) heißt der Gastgeber, ein gemachter Mann und Herr des Geldes, welcher den kleinen Fisch Frank Murnau (Dieter Geissler, mit einem in „Paul“ wiederkehrenden Rollennamen) gleichsam impulsiv und gelassen - quasi nach Art des Films - auf eine Mission schickt, Dokumente für Bares an einen Amerikaner in Rom zu schleusen. Die Details dazu werden alsbald MacGuffins im Ambiente geheimnisvoller Abgeklärtheit, in denen die Tatsachen aber so helle scheinen, wie sie die Schwarz-Weiß-Optik knallhart zu konzentrieren vermag. Das beinhaltet eben auch eine von Lemkes profunden Thesen, nämlich wie restlos erlegen man dem Blick einer Frau ist, komme was wolle. Gruners Tochter Laura (Christiane Krüger) ist sodann als Begleiterin ebenso dabei, schon träufelt die Sonne ins Gefährt und bringt die Laune der Bewegung, doch am pumpenden Bass bemerkt man bald Motive, die unter der Haube klopfen sowie die Pläne Franks durchkalkulieren lassen. Immer nur wenige Worte reichen für die nächsten Minuten aus, seine stille Eleganz öffnet Wege und lässt doch so vieles verborgen. Manchmal glaubt man wirklich, er könne im Moment an der Spitze der Welt stehen. Dann wiederum bleiben aber noch die wilden Momente, eben das grundsätzlich Menschliche zwischen den Zeilen: Liebe, Ungeduld, Schulden und Schwäche. Dass er vor Laura nur ersteres zeigt, macht ihn groß; doch es ist scheinbar nur gespielt, wenn er alles doch zwischenzeitlich für eine andere, Monika (Monika Zinnenberg), arrangiert, Gruners Plan zu seinem Gunsten umformuliert, so wie er von ihrer Erscheinung - nackt mit Zigarette - gebannt ist. Sicher wird er nachts auf den Straßen dadurch auch nicht, so wie sich der Topos Verfolgungsjagd anmeldet und den Schulden wegen einen nassen Klumpen an ihm hinterlässt, später vom einstigen Chef (Lemke selbst) aber noch einen halbwegs klärenden Spaziergang mitkriegt.
Es wird gequalmt und es qualmt. Allmählich wird es also Zeit zu verschwinden und da jettet der Film in mächtig Horizont-geißelnder Fahrt erstmals nach Rom, wo die Instrumentalversion von „Summer in the City“ mehr als nur unbewusst den Style hochpusht, obgleich die Erscheinung des Amerikaners Cameron (Roland Carey) jede Romantik von Geschäftswegen her unterbindet, die Frank und Laura seitdem so zwiegespalten knüpften. Es steckt dann auch jede Menge Frust in Franks Leberrausch, welcher sich daraufhin in Camerons Strandhaus ausschlafen muss, während dieser mit Laura in den Wellen vögelt, wie sich die gemachten Macher der Erde eben an jener austoben. Gegen eine Ladung Blei sind sie aber auch nicht gewappnet, so schnell und vergänglich Vertrauen, Gefühle und Geschäfte zusammenbrechen, wenn das vergänglichste von allen, das Geld, zum Ego lockt. Frank bleibt vor Laura stoisch, doch von ihr weg geht der Film mit ihm daraufhin in den Panik-Modus über, fliegt nach Mexiko und von dort aus nach Acapulco, so wie sich die Paranoia an Verfolgern bestätigt, die Bilder umso straffer die Schlinge um den Hals ziehen, je weniger Worte in den Schlund zwingen. Letzterer ist aber auch ein selbstgewählter; ein Träumer, der unmöglich das kriegen kann, was er verlangt, auch nicht die Frau. In dem Ambiente schielt das Leben noch heraus, das Singen über Kalifornien und die letzte innige Begegnung mit dem Frieden inmitten pechschwarzer Gefahr, doch für den Pathos der Melancholie hat Lemke da letztendlich wenig übrig, auch wenn er nicht zum Zynismus abdriftet. Der Eskapismus verschlingt sich stattdessen selbst und da wird das Begräbnis kalt wie grandios, von seiner Form in die Konklusion gesteuert und dennoch stets mit Lust nach Knarren, Karren und Scheinwerfer gesehnt. Die Wiederauferstehung ließ nicht allzu lange auf sich warten, doch der Weisheit letzter Schluss konnte im neuen deutschen Kino so keiner richtig benennen.
SAN ANDREAS - So wie die Saison an explosiver
Kinoware mit sommerlichen Flair allmählich früher abzieht als
gedacht und damit kurioserweise auch dem Wetter folgt, empfiehlt es
sich, auch mal einen Blick zurück zu wagen und das Heimkino für
einige schöne Stunden der Alltagsflucht zu bemühen. Dann begegnet
nämlich seiner Erinnerung: Hey, 2015 hatte doch noch diesen
Katastrophenfilm mit Dwayne „The Rock“ Johnson in petto und
obwohl vielerlei an seiner äußeren Fassade nach der Standardklausel
des Genres schreit, bemüht sich Regisseur Brad Peyton nicht nur um
eine effektive Konzentration der vertrauten wie willkommenen Topoi,
sondern bastelt für das Unterbewusstsein auch eine äußerst
menschliche Erfahrung inmitten der digitalen Zerstörungsorgie darin
hinein, aus welcher eine ganz saftige Ladung Herzblut geschöpft
wird. Vieles davon hängt anfangs dennoch mit einer Charakterisierung
zusammen, wie sie ein Roland Emmerich nicht weniger simplistisch
auffahren, höchstens mit noch mehr Charakteren füllen und eine
Ballung an Stereotypen riskieren würde. Das Geschehen bleibt hier
stattdessen strikt auf höchstens zwei Handlungslinien befestigt: Den
Experten und den Menschen, die in gewöhnlicheren Berufungen mit dem
Desaster zu hadern haben. Im Grunde wäre zweitere Ebene zwar
vollkommen ausreichend gewesen, wenn man bedenkt, dass die erstere -
via Paul Giamatti als seismologischer Wissenschaftler Dr. Lawrence
Hayes - mehr darauf konzipiert ist, Plausibilität in die
Geschehnisse zu infusieren, als dass sie mehr zur Grundthese
individueller Willenskraft im Angesicht der Überwältigung addieren
würde. Immer wieder goldig zwar, wie Amerika anhand jener Ideologie
in Filmen über den Dingen stehen kann, indem der gesellschaftliche
Struggle am stellvertretenden Beispiel gelöst zu werden scheint (und
die Suggestion leistet sich Peyton mit dem epischsten Pathos im
Regal), doch hier kommen noch Ideale ins Spiel, die Distanz und Nähe
zugleich hervorrufen.
Jemand, der mit Raymond Gaines
(Johnson) und seiner Erscheinung mithalten kann, möchte man dieser
Tage jedenfalls dringend öfter vorfinden. Fakt ist, dass er als
Meister im Rettungseinsatz zwar den lockeren raushängen lassen kann
und mit seiner Statur zu jeder (bereits zu Beginn bewiesenermaßen
noch so unmöglichen) Heldentat fähig ist, aber eben auch mit der
anstehenden Scheidung von seiner Frau Emma (Carla Gugino) zu hadern
hat. Die Gründe dafür liegen sodann am Trauma, eine der zwei
gemeinsamen Töchter verloren zu haben, gerade ihr nicht zu helfen
imstande gewesen zu sein. The Rock hält sich in der
Darstellung dieser Trauer überraschend zurück, nicht weil man ihm
Talentfreiheit attestieren muss, so wie insbesondere das letzte
Drittel (nicht bloß an ihm) den genuinen Ausbruch offenbart, wenn das trotz aller
Umstände Gebliebene ihm erneut zu entgleiten droht. Er bleibt eben
auch sich selbst treu und demnach kein Stoiker, doch der designierte
Held lässt sich an ihm durchweg festmachen, so wie das Genre seine
Protagonisten nun mal projiziert und zudem mit Angehörigen
ausstattet, die dessen Werte reflektieren und für den eigenen
Selbstbeweis umsetzen. Beispiellose Güte und Bescheidenheit sind
demnach seine Markenzeichen im Kontrast zu seiner Erscheinung,
durchweg besonnen verhält er sich auch gegenüber seiner der Zukunft
ungewissen Ex, weshalb beide im Zusammenspiel stets den Konstanten von
Streit und Häme entgehen, als hätte der Film eine Utopie zur
Beobachtung ausgestellt. Gleiches gilt für die Tochter Blake
(Alexandra Daddario), von der ein Charakter später behaupten wird,
dass sie schlicht unglaublich sei - und damit gar nicht mal falsch liegt. Die äußere und innere Schönheit
wie Kompetenz an dieser Frau übertrifft sogar manch Superhelden in
der Vorbildfunktion, gibt dennoch weder die durchsexualisierte
Gafferfläche noch den Übermenschen, wenn nur die wenigsten
Situationen ohne die Hilfe der Gemeinschaft zu meistern sind.
Dennoch übt sich der Film natürlich
im Habitus, dem großen Massensterben inmitten jener Parteien nur
bedingt adäquat emotional begegnen zu können, auch wenn die
Darstellung dessen wenig Halt macht, digitale Körper in gespaltene
Straßen, Tsunamis, Wirbelstürme und Brände zu werfen. Ohnehin
klingen wiederum einigermaßen befremdliche Zwischentöne auf, wenn
dieser Vertreter des kontemporären Blockbusters ebenso gierig
dem Untergang frönt, eine Materialschlacht am Computer unter die
3D-Brillen streut und zweifellos an der Exploitation
teilnimmt. Die Erwartungen werden also auch erfüllt,
gleichsam sind die Antagonisten dann auch Abgekoppelte von
grundlegender Empathie, klassischen Familienmodellen und auch so
gnadenlos überzeichnet, dass ihr Ableben objektiv gesehen schon
zynische Töne mitbringt. Wichtig ist hier aber, von wessen
Perspektive diese Ereignisse gezeigt werden, wie sie eine ungefähre
Katharsis für den Sachverhalt der Filmfigur ergeben und jenseits von
Gut und Böse einen inneren Prozess reflektieren. Mithilfe von Dr.
Hayes scheint der Film von dieser Deutung beinahe ablenken zu wollen,
doch zu beinahe jeder Minute steht das Verhältnis der Familie Gaines
zur Debatte, wie sie ein zerstörtes Stück von sich selbst mit
Ersatzlösungen zu glätten versuchen, bis der Schmerz in angestauten
Übermengen ausläuft und mit dem Drang zur letzten, aber möglichen
Chance konfrontiert. Die Mechanismen einer Scheidung und den
Wiederaufbau anhand eines solchen Films zu verstehen, mag absurd
klingen, doch vielerlei Signale tragen die Botschaft front and
center ins Bewusstsein, wenn man neben der offensichtlichen
Spaltung Kaliforniens vom Rest Amerikas (welche wohlgemerkt über den
ganzen Kontinent zu spüren sein wird) z.B. den Stiefvater in spe
auscheckt. Dabei ist der millionenschwere Architekt Daniel Riddick
(Ioan Gruffudd) in seiner Fassung außerhalb der Erdbeben-Begegnung
kein von Vornherein konspirierendes Monster oder dergleichen, doch er
teilt schon früh seine Unerfahrenheit mit der Erziehung mit, so wie
er sein Leben lang eher seine Gebäude aufzog.
Das Eingeständnis wäre plump, wenn er
sich im Endeffekt wirklich nur um sein Werk kümmern würde,
stattdessen gibt es sein unqualifiziertes Verständnis der ihm
angetrauten Familie preis, die er im Angesicht der Verzweiflung und
eigener Hilflosigkeit sogar im Stich lässt, auch wenn der Film sein
Bewusstsein dazu offen hält (wie seine Orientierungslosigkeit parallel mit die größte Furcht innerhalb jener Katastrophen repräsentiert). Wirklich subtil wird die Sache nicht
gehandhabt, doch Regisseur Peyton will gewiss nicht die Ahnung einer
Prätention ermöglichen, wenn sich anhand der großen Show doch so
viele kleine Wahrheiten spielerisch aufzeichnen lassen. Dafür darf
Kylie Minoque als Riddicks Schwester schon früh die giftige Tante
ansetzen und sterben lassen, indem das Erdbeben jene Sache erledigt,
ehe Emma und Blake auf ewig mit ihr zusammenhängen müssen. Später
wirft scheinbar schon jede Erwähnung der Riddicks ein böses Omen
auf das Weiterkommen der Wiedervereinigung, der Anblick eines seiner
im Bau befindlichen Wolkenkratzer allein erzeugt wohl schon ein
Nachbeben. Es ist alles over-the-top und in der Direktheit
auch ein schön anpackender Faktor, wenn man die
Selbstverständlichkeiten betrachtet, mit denen sich die
Familienmitglieder wieder den Weg zueinander bahnen, bei der Hemmung
in der Reflexion zur Vergangenheit einer geographischen Hürde
begegnen und im Gegenzug abheben, wenn Einsicht und Aussprache die
Klärung untereinander bringt, das eben noch nicht alles verloren
ist. Ohnehin belohnt „San Andreas“ die Positionierung zur
positiven Menschenkenntnis im Taylor-Gespann, welches in seiner
Brüderlichkeit schnell mit Blake zusammen findet, wenn sie sich auf
Charakterwerten der Vernunft und Hilfe gegenseitig stützen, dafür
ihre Handy-Nummer absahnen und diese dennoch als erstes dazu
benutzen, um sie im Geröll zu finden.
Triviale Impulse darf man hier durchaus
nicht ausschließen, doch an der vermittelten Kohärenz findet sich
dann doch ein humanistischer Ansatz ein, der sich zum Finale hin
immer mehr steigert, obgleich die kleinen Helden ganz groß werden und sich sogar Zeit nehmen, um Plündereien zu vereiteln oder alten Mitmenschen den Superjeep zu überlassen.
Monsterwellen, Frachter und einstürzende Stadien in deren Gegenwart werden
bezwungen, weil das Vertrauen sich nicht mehr hemmen will und trotz
der Angst durchzieht. Letztere bleibt ja dennoch bestehen und spielt
erst recht auf, wenn die Tapferkeit der Güte scheinbar nach all dem
überstandenen Größenwahn voller Naturgewalten an der vom Menschen
geschaffenen, ferner von Riddick installierten Panzerglasscheibe zu
scheitern droht. Vor allem, da jene Situation genau das Trauma
wiederholt, welches die Gaines-Familie schon viel zu lange mit sich
trägt, als wären sie im Limbus gefangen, was am Medium Film sowie
an der vorherrschenden Haltlosigkeit des Chaos ohnehin kein allzu
falscher Gedanke wäre. Dass Peyton da durchaus auf reeller Ebene die
Emotionen herausholen kann, ist ihm ja zweifelsohne gegeben, doch das
Szenario ist an sich nicht mal etwas Besonderes im Wust an
Jahrzehnte-langer Genre-Installation, dass es umso mehr beeindruckt,
wenn es eben nur in seinem Rahmen noch so intensiv beim Zuschauer
ankommt und sich dafür nicht mal einen Bruch heben muss. Selbst den
Käse mit der Flagge am Ende noch aufzutischen (neben vielen Klischees, die vermieden wurden), verbittert die
Erfahrung noch nicht mal, sondern scheint nur konsequent in dieser
Fantasie einer Schmerzbewältigung, die selbst inmitten des
plattentektonischen Genozids geradewegs zum Optimismus zu steuern
fähig ist. Ist das noch aufrichtig unbedarft oder ein verstecktes
Epos über das Bestehen der Menschlichkeit vom Innern heraus?
Wahrscheinlich beides.
Bonus-Zeugs:
Diese Woche habe ich knapp 11700 Wörter und so ziemlich einen ganzen Samstag an Arbeit in folgendes Video gesteckt, das sich in etwa als Fortsetzung zu jener Batman-v-Superman-Geschichte anhören lässt, die ich im April schrieb, aber gleichzeitig auch ein Stück spekuliert und reflektiert, was ich von nachfolgenden Werken des DCEU erwarte oder eben nicht. Es geht genauer um die heiß erwartete Zusammenführung der Justice League und wenn sich ein Stoff für Räudige Hoschi-Fiction anbietet, dann diese dramaturgisch durchweg haarsträubende Baustelle voller bescheuerter Witze. Ich beneide niemanden in der Position, einen stimmigen Film draus zu machen und hoffe auf das Beste oder eben Merkwürdigste von Zack Snyder. Solange dürfte mein Projekt zum Anhören vielleicht nur Hardcore-Fans sättigen, aber im Nachhinein macht ein Vergleich wohl auch Spaß. Wie auch immer der Schlussstrich gezogen wird, würde ich mich freuen, wenn sich ein Leser hier auch dafür entscheidet, mir für knapp 86 Minuten zuzuhören. Ich hätte an dieser Stelle sonst gerne auch schon Texte für die Ultimate Edition von Batman v Superman (sehr gut, vor allem in Sachen Superman eine profunde Ergänzung) sowie Suicide Squad (enttäuschendes Mittelmaß ohne ersten Akt) anbieten können, doch die harren noch ihrer Veröffentlichung, was eben außerhalb meiner Kontrolle liegt. Unter diesen Umständen aber nicht vergessen: Danke im Voraus und viele Grüße aus der kreativen Höhle!

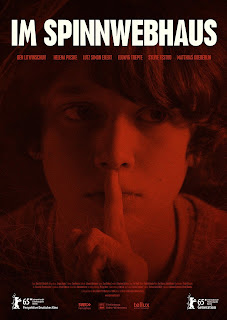






























Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen